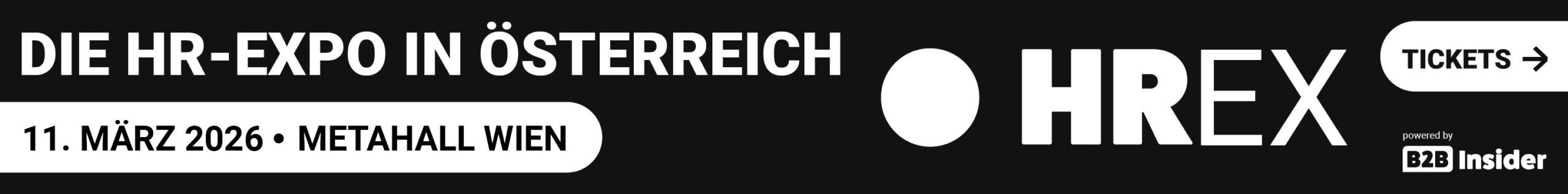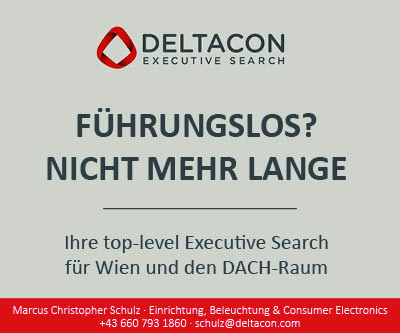Es gibt Menschen im Unternehmen, die uns sofort ein leichtes Unbehagen verursachen. Sie sind nicht unfreundlich, nicht destruktiv, aber …
Sie bohren nach. Und sie widersprechen. Sie zeigen auf, wo etwas nicht stimmig ist. Kurz: Sie sind unbequem. Und genau deshalb sind sie oft die besten. Perfekt, um es bewusst als Führungsinstrument einzusezten?
Unangenehm? Oder einfach ehrlich?
Wir sprechen hier nicht von jenen, die ständig nörgeln, jede Entscheidung schlechtreden und aus Prinzip dagegen sind. Dauer-Nörgler bremsen den Fortschritt, statt ihn zu fördern.
Aber es gibt eine zweite Kategorie: die scharfsinnig Kritisierenden, die den Finger auf wunde Punkte legen. Nicht um zu dominieren, sondern um zu verbessern.
Diese Menschen sehen, was andere übersehen. Sie sprechen aus, was alle denken, aber niemand zu sagen wagt. Und sie sind jene, die Organisationen langfristig robuster machen.
Psychologische Sicherheit: Ohne Widerspruch kein Fortschritt
Die Harvard-Forscherin Amy C. Edmondson hat das Konzept der psychological safety geprägt – also jenes Klima, in dem Teammitglieder das Gefühl haben, sich offen äußern zu dürfen, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen. Studien zeigen: Teams mit hoher psychologischer Sicherheit sind innovativer, lernfähiger und treffen bessere Entscheidungen (Edmondson, Harvard Business Review, 2019).
Aber psychologische Sicherheit bedeutet nicht, dass es immer harmonisch zugeht. Im Gegenteil: Ein gewisses Maß an Reibung ist notwendig, um Denkfehler zu korrigieren und blinde Flecken zu erkennen.
Unangenehme Mitarbeitende sind oft jene, die diese Reibung erzeugen. Und damit die Voraussetzung für echte Lernkultur schaffen.
Studien zu psychologischer Sicherheit
[Quellen unten]
- Der Schlüsselbegriff lautet psychologische Sicherheit. Amy C. Edmondson prägte diesen Begriff und zeigte in ihrer Studie “Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams”, dass das Empfinden, sich im Team offen äußern zu können, eng mit Lernverhalten und Teamleistung zusammenhängt.
- Neuere Untersuchungen erweitern dieses Modell: In einer Studie mit 104 Teams aus Südkorea zeigte sich, dass psychologische Sicherheit nicht direkt Teamleistung steigert, sondern indirekt: über gesteigerte Lernaktivität und wahrgenommene Effektivität.
- In einer Untersuchung unter 160 norwegischen Managementteams fand sich ein signifikanter indirekter Effekt: Psychologische Sicherheit führte über Verhaltensintegration (also Zusammenarbeit, Informationsaustausch) zu höherer Teamleistung.
- Diese Ergebnisse belegen: Psychologische Sicherheit allein reicht nicht aus – sie wirkt über konkrete Mechanismen auf Leistung und Innovation.
- Eine neuere Übersichtsarbeit zeigt, dass psychologische Sicherheit heute in vielen Management- und Arbeitskontexten als etabliertes Forschungsfeld gilt, mit klaren Einflussfaktoren und Folgen.
Zusammengefasst: In Teams, die sich sicher fühlen, treten Menschen eher mit Zweifeln, Bedenken und alternativen Perspektiven hervor. Das ist keine Störung, sondern eine zentrale Ressource für kollektives Lernen.
Der Unterschied zwischen Kritik und Querulantentum
Die Kunst für Führungskräfte besteht darin, zu unterscheiden:
- Kritik zur Verbesserung ist konstruktiv, faktenbasiert und lösungsorientiert.
- Kritik zur Selbstprofilierung hingegen blockiert und zersetzt.
Und dann ist es ein perfektes Führungsinstrument. Nämlich, um die erst dieser beiden Gruppen zu stärken und dieses Verhalten aktiv zu fördern.
Weshalb Führung unangenehm sein muss
Viele Führungskräfte neigen dazu, Harmonie zu priorisieren. Verständlich: wer möchte schon Konflikte? Doch in der Führungsforschung gilt als gesichert: Bequemlichkeit ist der Feind von Klarheit.
Der Organisationspsychologe Adam Grant argumentiert in Think Again konkret:
„We learn more from people who challenge our thought process than those who affirm our conclusions.“
Diese Formulierung verdeutlicht, dass Führung sich nicht durch das Vermeiden von Kritik auszeichnet, sondern durch das Aushalten und Nutzen von Kritik.
Doch Vorsicht: Nicht jede Stimme, die laut ist, ist automatisch wertvoll. Widerspruch wird produktiv, wenn er:
- inhaltlich begründet ist (mithilfe von Daten, Erfahrung oder Logik)
- Lösungsorientierung ausdrückt (nicht nur Argumentation gegen etwas, sondern Impuls zum Bessern)
- nicht auf Dominanz zielt (kein Machtspiel, sondern Beitrag)
Wenn diese Kriterien nicht erfüllt sind, verwandelt sich kritische Stimme in destruktiven Querulantismus. Dann hat es als Führungsinstrument fehlgeschlagen.
Führungsinstrument: Konstruktiven Widerspruch kultivieren
- Fragen statt verteidigen: Wenn Kritik kommt, nicht sofort argumentieren. Erst verstehen.
- Widerspruch sichtbar machen: In Meetings gezielt nach Gegenargumenten fragen („Was spricht gegen diese Idee?“).
- Rituale schaffen: „Devil’s Advocate“-Rollen fördern strukturierten Widerspruch, ohne persönliche Fronten aufzubauen.
- Feedbackkompetenz trainieren: Sowohl inhaltlich (Wie formuliere ich Kritik?) als auch emotional (Wie nehme ich sie an?).
Denn nur wer Kritik annehmen kann, darf führen.
Persönliches Fazit
Bei HRweb habe ich so eine Kollegin. Sie bohrt. Immer wieder. Bis aus meinem „Ja, aber“ ein „Ja“ wird. Und ja, angenehm ist das nicht.
Aber genau darin liegt ihr Wert. Sie zwingt mich, meine Gedanken zu schärfen. Und sie erinnert mich daran:
„Unangenehm“ ist nicht das Gegenteil von „wertvoll“.
Es ist oft nur das Gegenteil von „bequem“.
Und mit Bequemlichkeit lässt sich kein Unternehmen in die Zukunft führen.
Die unangenehmen Mitarbeitenden sind mir die liebsten | Widerspruch als wertvolles Führungsinstrument
Quellen
- Massachusetts Institute of Technology
- How Psychological Safety Affects Team Performance (Frontiers / PMC)
- The Relationship between Psychological Safety and Management Teams (PMC)
- Psychological Safety Comes of Age: Observed Themes (Annual Reviews)
- A concept analysis of psychological safety (PMC)
- Grant, A. Think Again – Zitat via Goodreads („We learn more …“)
- „Four Steps to Building Psychological Safety“ (HBS / Working Knowledge) (Harvard Business School Library)