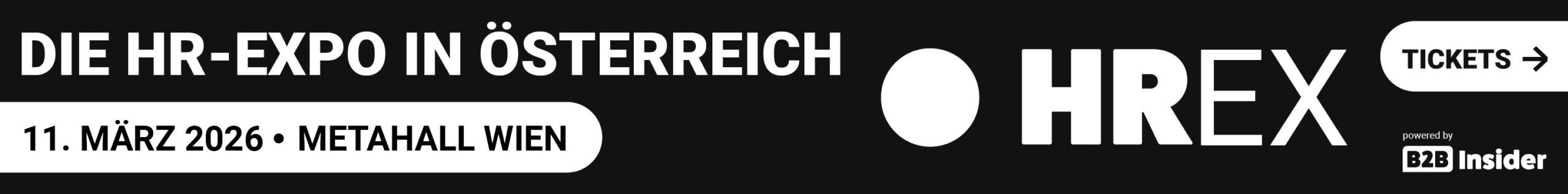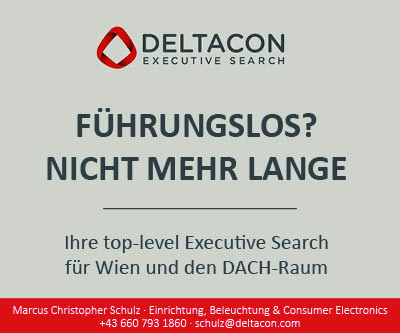Die EU-Entgelttransparenz-Richtlinie verlangt ab jun2026 von allen Unternehmen ab 100 Mitarbeitenden umfassende Transparenz der Gehaltsstruktur. Mit der rechtlichen Umsetzung der Richtlinie in Österreich wird demnächst gerechnet.
Die Entwicklung transparenter Gehaltsstrukturen ist nicht nur eine Compliance-Übung, denn in vielen Unternehmen geht es um die Neugestaltung der Vergütungsarchitektur. Dieser Fahrplan führt systematisch durch die wesentlichen Schritte.
Warum ein strukturierter Ansatz entscheidend ist
Entgelttransparenz bedeutet einen fundamentalen Wandel in der Unternehmenskultur. Unternehmen, die unstrukturiert vorgehen, riskieren nicht nur Compliance-Verstöße und Sanktionen, sondern auch erhebliche Unruhe in der Belegschaft. Ein strukturierter Ansatz minimiert diese Risiken, schafft eine objektive Grundlage für Gehaltsentscheidungen und macht aus einer gesetzlichen Pflicht im besten Fall sogar einen strategischen Vorteil im Wettbewerb um Talente.
Der 8-Schritte-Fahrplan für KMU
Schritt 1: Rahmenbedingungen verstehen
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die rechtlichen Anforderungen für Ihr Unternehmen. Die Pflichten variieren je nach Unternehmensgröße und Standort. In Österreich sind Gehaltsangaben in Stellenausschreibungen bereits verpflichtend. Ab jun2026 kommen durch die EU-Entgelttransparenzrichtlinie weitreichende Pflichten hinzu: Unter anderem geht es um ein individuelles Auskunftsrecht der Mitarbeitenden, Verbot von Gehaltsgeheimhaltungsklauseln und die Beweislastumkehr bei Diskriminierungsvorwürfen.
Das macht eine lückenlose Dokumentation aller Gehaltsentscheidungen unverzichtbar. Das Gender Pay Gap Reporting führt man gestaffelt ein: Unternehmen mit 250 oder mehr Mitarbeitenden müssen ab 2027 jährlich berichten. Die Erfahrung zeigt, dass die Umsetzung je nach Unternehmensgröße meist mehrere Monate dauert. Frühzeitig mit der Beschäftigung mit dem Thema zu beginnen, ist daher empfehlenswert.
Schritt 2: Systematische Gehaltsstruktur aufbauen
Eine transparente Gehaltsstruktur bildet das Fundament. Der zentrale Baustein ist ein Stellenbewertungssystem, das Positionen nach objektiven Kriterien bewertet. Zulässig sind nachweisbare Berufserfahrung, messbare Leistung oder die Größe des Verantwortungsbereichs. Unzulässig sind Geschlecht, Alter, Familienstand oder persönliche Sympathie.
Auf dieser Basis definiert man Gehaltsbänder, die für jede Stellengruppe einen Minimum-, Mittel- und Maximalwert festlegen. Eine bewährte Bandbreite liegt bei marktüblichen Gehaltsvergleichen bei plus / minus fünfzehn bis zwanzig Prozent um den Mittelwert. Entscheidend ist die schriftliche Dokumentation, welche Faktoren Gehaltsunterschiede rechtfertigen.
Schritt 3: Vergleichsgruppen definieren
Mitarbeitende erhalten das Recht, Informationen über das Entgeltniveau ihrer Vergleichsgruppe zu erhalten. Vergleichbare Arbeit liegt vor, wenn Tätigkeiten entweder gleich oder gleichwertig sind. Die Kriterien für Vergleichsgruppen sollten die festgelegten Kriterien, also etwa Qualifikationsanforderungen, Verantwortungsumfang und Arbeitsbelastung berücksichtigen. Diese Faktoren dürfen innerhalb einer Vergleichsgruppe zu Gehaltsunterschieden führen, aber nicht zur Bildung separater Gruppen verwendet werden.
Schritt 4: Gehaltsbandbreiten berechnen
Für jede Vergleichsgruppe müssen die passenden Gehaltsbandbreiten berechnet werden. Bei der Validierung muss geprüft werden, ob alle aktuellen Gehälter innerhalb der definierten Bandbreiten liegen. Ausreißer müssen identifiziert und bewertet werden: Ist das objektiv anhand von Kriterien begründbar oder muss eine Anpassung erfolgen?
Schritt 5: Differenzierungskriterien festlegen
Innerhalb der Gehaltsbandbreiten muss klar geregelt sein, nach welchen Kriterien individuell differenziert werden darf. Diese Kriterien müssen objektiv, messbar und geschlechtsneutral sein. Zulässig sind beispielsweise Berufserfahrung im spezifischen Fachgebiet, messbare Leistung durch standardisierte Performance-Reviews, Verantwortungsbereich und Arbeitszeit, aber auch die Situation des Arbeitsmarkts zum Zeitpunkt der Rekrutierung. Unzulässig sind alle Faktoren, die mit persönlichen, nicht berufsspezifischen Merkmalen zusammenhängen, wie etwa Geschlecht, Alter oder Herkunft. Die Dokumentation sollte in einer schriftlichen Vergütungsrichtlinie erfolgen, die für die gesamte Belegschaft verbindlich ist.
Schritt 6: Auskunfts- und Beschwerdeprozesse etablieren
Ab 2026 braucht es klare Prozesse für die Bearbeitung von Auskunftsanfragen. Definieren Sie, wie Mitarbeitende eine Anfrage stellen können, etwa durch ein standardisiertes Formular. Die Zwei-Monats-Frist zur Beantwortung beginnt mit Eingang zu laufen. Die Auskunft muss laut Richtlinie Informationen über die Entgeltkriterien und das durchschnittliche Entgeltniveau der Vergleichsgruppe enthalten, aufgeschlüsselt nach Geschlecht. Parallel dazu braucht es einen klaren Beschwerdeweg bei vermuteter Diskriminierung. Mitarbeitende sollten wissen, an wen sie sich wenden können. Die gesamte Bearbeitung sollte man dokumentieren.
Schritt 7: Gender Pay Gap analysieren
Die Berechnung des Gender Pay Gap ist nicht nur gesetzliche Pflicht, sondern auch ein Instrument zur Qualitätssicherung. Man unterscheidet zwischen einerseits unbereinigtem und andererseits bereinigtem Gap. Der unbereinigte Gap misst den durchschnittlichen Gehaltsunterschied zwischen allen männlichen und weiblichen Beschäftigten, sogar unabhängig von der Frage, ob Mitarbeitende Teilzeit oder Vollzeit gearbeiten. Der bereinigte Gap vergleicht nur Männer und Frauen in vergleichbaren Positionen auf Vollzeitbasis und zeigt, ob es bei vergleichbarer Arbeit Gehaltsunterschiede gibt. Nutzen Sie entweder HR-Software oder Excel-Templates für die Analyse und identifizieren Sie statistische Auffälligkeiten in Abteilungen oder Hierarchieebenen.
Schritt 8: Abweichungen bereinigen und kommunizieren
Bei unbegründeten Gehaltsunterschieden von fünf Prozent oder mehr zwischen den Geschlechtern muss binnen sechs Monaten eine Korrektur erfolgen. Planen Sie Budget für notwendige Anpassungen ein. Die Kommunikation ist entscheidend: Erklären Sie Mitarbeitenden nicht nur das Ergebnis, sondern auch den Prozess. Wie kommt das individuelle Gehalt zustande? Erstellen Sie eine FAQ-Liste für häufige Rückfragen und binden Sie den Betriebsrat frühzeitig ein. Transparenz nicht nur über die Ergebnisse, sondern auch zur Vorgehensweise schafft größere Akzeptanz für Gehaltsentscheidungen.
Fazit (EU Entgelttransparenzn Gehaltsstruktur)
Die Umsetzung der Entgelttransparenz erfordert Zeit, Ressourcen und strategisches Vorgehen. Wer die acht Schritte systematisch abarbeitet, schafft nicht nur Rechtssicherheit, sondern auch eine faire, nachvollziehbare Vergütungsstruktur. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Kombination aus objektiven Strukturen, transparenter Kommunikation und konsequenter Dokumentation. Gehaltsunterschiede darf es selbstverständlich auch in Zeiten der Entgelttransparenz geben. Einzige Bedingung: Sie müssen objektiv nachvollziehbar, gut dokumentiert und unabhängig vom Geschlecht sein.
8-Schritte-Fahrplan zur EU-Entgelttransparenz | Rechtssichere Gehaltsstruktur für KMU